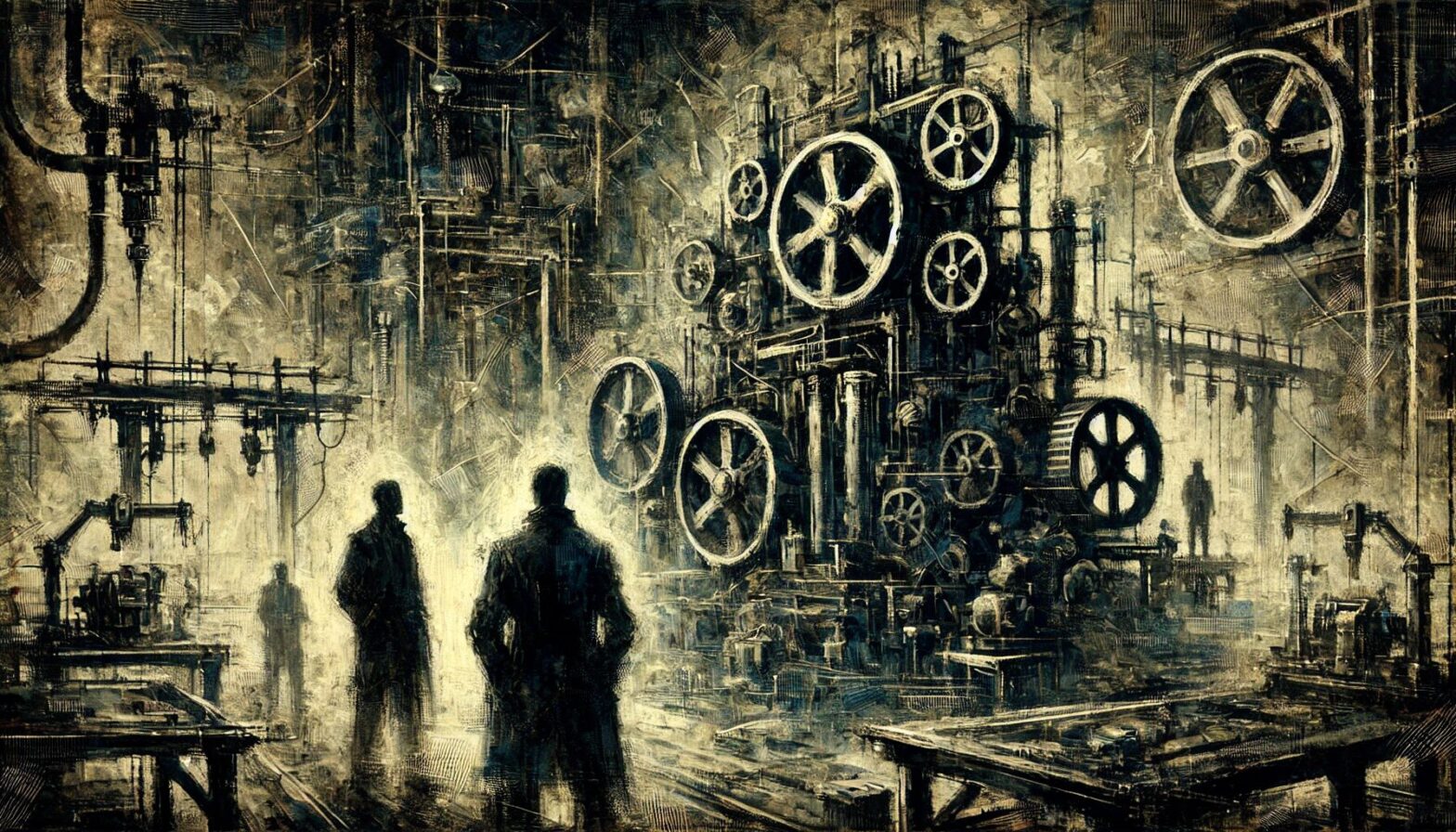In diesem Text wird versucht, ein „Denkmodell“ über Organisationen zu formulieren, und zwar ausgehend vom Zweck einer Organisation. Der Beitrag ist Teil der Texte zu meiner Vorlesung zum Thema Organisationspsychologie an der Dresden International University. Ausgangspunkt des Textes ist ein eher einfaches Beispiel, das wir auch schon an anderer Stelle als Grundlage für die ersten Betrachtungen verwendet haben.
Teil 1: Grundlegendes Beispiel
Zwei Führungskräfte sprechen nicht mehr miteinander. Dabei müssten sie es.
Der eine ist Maschinenführer. Ich habe ihn kennengelernt und den Eindruck gewonnen, dass er „seine“ Maschinen besser kennt als seine Familie. Er hört, sieht und „fühlt“ jede Abweichung.
Der andere ist leitender Ingenieur. Er denkt nicht nur an die Maschinen, sondern an den gesamten Produktionsprozess. Er entwickelt Lösungen, die nicht nur kurzfristige Probleme beheben, sondern das große Ganze optimieren. Aber seine Erklärungen sind so abstrakt, dass weder ich noch der Maschinenführer sie verstehen.
Das Problem ist schnell beschrieben:
• Der Maschinenführer hält den Ingenieur für einen Theoretiker, der keine Ahnung von der Praxis hat.
• Der Ingenieur hält den Maschinenführer für stur und schwer zugänglich.
Das Ergebnis?
• Man spricht nicht mehr miteinander.
• Der eine kommt früh, ändert Einstellungen, damit „die Sache läuft“.
• Der andere kommt später, sieht das „Chaos“, stellt wieder um.
• Die Ausschussquote bleibt hoch, Schuldzuweisungen fliegen hin und her.
Der Produktionsleiter erkennt, dass so keine stabile Produktion möglich ist, und bittet um eine Intervention.
Der Lösungsweg
Zunächst führe ich Einzelgespräche mit beiden.
Drei einfache Fragen bringen die Erkenntnis:
1. Mit wem müssten Sie eigentlich an einer Lösung arbeiten?
• Beide nennen den jeweils anderen.
2. Was müsste sich ändern, damit das Problem gelöst wird?
• Beide haben ähnliche Erwartungen.
3. Wer müsste den ersten Schritt machen?
• Schweigen. Und dann: „Eigentlich könnte ich anfangen…“
Die Intervention beginnt bereits hier – nicht in der Aussprache, sondern in der Erkenntnis, dass sie nicht auf den anderen warten sollten.
Die Aussprache
In der gemeinsamen Aussprache stelle ich nur Fragen:
• Was ist Ihnen in den Einzelgesprächen klar geworden?
• Was möchten Sie ändern?
• Wie müsste die Zusammenarbeit aussehen, damit sie den Produktionszielen dient?
• Was können Sie selbst dazu beitragen?
• Was hat Sie verletzt?
• Wofür möchten Sie sich entschuldigen?
• Welche Erwartungen haben Sie aneinander?
• Anhand welcher Gewohnheiten oder Regeln könnte man erkennen, dass es funktioniert?
Es braucht keine langen Diskussionen, keine Mediation, keine endlosen Analysen. Es reicht, dass sie einander zuhören – und erkennen, dass sie nicht Gegner sind, sondern Partner, die gemeinsam auf den Zweck des Unternehmens einzahlen müssen.
Das Ergebnis
• Weniger Schuldzuweisungen.
• Mehr Fragen stellen, statt direkt zu kritisieren.
• Irritationen ansprechen, statt zu ignorieren.
• Klare Absprachen, um gegenseitige Änderungen an den Maschinen zu vermeiden.
Fazit: Kommunikation ist Arbeit – aber sie spart Arbeit
Es ist nicht selbstverständlich, dass ein festgefahrener Konflikt mit wenigen Gesprächen gelöst wird, wie das in diesem Fall gelungen ist. Oft braucht es mehrere Termine. In der Regel empfehle ich einen Prozess mit drei bis fünf Terminen.
Besonders festgefahrene Situationen profitieren davon, wenn man zuerst Einzelgespräche führt, bevor eine gemeinsame Aussprache versucht wird. Warum das so ist, erkläre ich in diesem Video.
Lessons learned
• Führung heißt nicht, Erwartungen durchzusetzen – sondern sie zu synchronisieren. Letztlich geht es um die Erkenntnis, gemeinsam auf den Zweck der Organisation einzuzahlen und die jeweiligen Sichtweisen und Belange aufeinander abzustimmen.
• Ein Unternehmen kann sich nicht leisten, dass zwei Schlüsselpersonen sich gegenseitig blockieren.
• Es kostet immer weniger Energie, frühzeitig zu reden, als später Konflikte zu bearbeiten.
Teil 2: Überblick über die Theorie „dahinter“
Die Erinnerung daran, dass man in einem Betrieb gemeinsam auf den Zweck des Betriebes „einzahlen“ soll, also Handlungen so koordinieren soll, dass das Bestmögliche im Sinne dieses Zwecks dabei herauskommt, und dass man quasi dazu „irgendwie verpflichtet“ ist, hatte in dem soeben geschilderten (eher einfachen) Fall bereits geholfen. Die aufgelisteten Fragen waren dabei nur Mittel zum Zweck. Ziel war die Erinnerung an die besagte „Verpflichtung“ zur Zusammenarbeit im Hinblick auf den Zweck der Organisation. Idealerweise existiert diese „Verpflichtung“ als eine Art „Selbstverpflichtung“, die einen nicht nur dazu bringt, die eigenen Aufgaben so gut wie möglich zu erledigen, sondern gemeinsam mit anderen auch an einem möglichst reibungsarmen Ablauf zu arbeiten, ggf. Ideen einzubringen usw.
Es lassen sich im Prinzip mehrere Aspekte und Ebenen denken, die zum Verständnis und zur Analyse dessen, was eine Organisation ist und wie die Handlungen in einer Organisation strukturiert sind, beitragen — und zwar nicht nur in Unternehmen, sondern in jeder Organisation:
Zunächst gibt es da, wie schon beschrieben, (1) den Zweck der Organisation.
Zur Erreichung dieses Zwecks handelt es sich (2) um die Ebene dessen, was konkret getan wird, also den grundlegenden Handlungsablauf oder auch „Kernprozess“.
Des Weiteren geht es (3) um die Ebene der Koordination/Besprechung dessen, was wann und wie getan wird. Hier geht es auch um die Thematisierung von Fehlern (etwas hat nicht geklappt) und die entsprechende Verbesserung dessen, was getan wird.
Aus dem Zweck der Organisation ergibt sich zudem (4) die Struktur. Die Struktur besteht in den Funktionen, Positionen oder Rollen, die es braucht, um den Zweck der Organisation zu erfüllen. Rollen sind letztlich „Erwartungsbündel“. Aus dem Zweck der Organisation ergeben sich bestimmte Erwartungen, die, zu Rollen gebündelt, die Erfüllung des Zwecks einer Organisation sicherstellen. Einfach gesprochen kann man den Zweck der Organisation auf ein Flipchart schreiben und auf einem Tisch die einzelnen Rollen positionieren, beschreiben und anhand von „Praxisfällen“, also Anwendungsbeispielen oder konkreten Anforderungen oder Durchläufen so lange reflektieren, bis die Struktur klar ist.
Darüber hinaus geht es (5) um die Ebene derjenigen Dinge, die aus dem konkreten Tun mit der Zeit zu Selbstverständlichkeiten „kondensieren“, die also irgendwann nicht mehr hinterfragbar und nur sehr schwer zu verändern sind.
Schließlich gilt es, (6) den „menschlichen Faktor“ hinreichend zu berücksichtigen. Das gelingt am besten anhand des Konzeptes des psychologischen Vertrags. Der „psychologische Vertrag“ beschreibt die Beziehung einer handelnden Person zu ihrer Organisation. Der „psychologische Vertrag“ besteht aus gegenseitigen Erwartungen. Je klarer die Erwartungen der Organisation an die handelnde Person sind, desto genauer weiß die Person, was sie tun soll. Je klarer die Erwartungen der handelnden Person an die Organisation sind, desto genau weiß die Organisation, wie zufrieden, motiviert usw. das Organisationsmitglied ist und was getan werden muss, damit die handelnde Person ihre Aufgaben erfüllen kann, wie sie sich weiterentwickeln will usw. Hieraus ergibt sich der Führungszusammenhang. Führungskräfte haben letztlich die Aufgabe, die bestehenden psychologischen Verträge zu „moderieren“, also den Prozess des Einzahlens auf den Zweck der Organisation zu organisieren und sicherzustellen, dass die handelnden Personen zufrieden und motiviert bleiben und sich ggf. weiterentwickeln können.
Teil 3: Untersetzung der theoretischen Elemente und Ebenen
Zweck der Organisation (1)
Jede Organisation existiert aus einem bestimmten Grund. Sie ist kein zufälliges Gebilde, sondern eine strukturierte Antwort auf eine Notwendigkeit. Der Zweck einer Organisation bestimmt, was getan wird, wie es getan wird und warum es so getan wird.
Der Zweck ist das stabilste Element einer Organisation. Während Strukturen, Prozesse und sogar Kulturen sich verändern können, bleibt der Zweck in den meisten Fällen konstant. Er bildet das Ordnungsmuster, das Klarheit in das Denken über Organisationen bringt.
Vom Zweck zur Struktur
Sobald der Zweck klar ist, ergibt sich daraus die Struktur:
• Wer trägt welche Verantwortung?
• Welche Rollen sind notwendig, um den Zweck zu erfüllen?
• Welche Entscheidungswege müssen geschaffen werden?
Von der Struktur zum Ablauf
Die Struktur wiederum bestimmt die Abläufe:
• In welcher Reihenfolge müssen Tätigkeiten erfolgen?
• Welche Schnittstellen gibt es zwischen den Bereichen?
• Wo liegen Engpässe oder Reibungsverluste?
Von den Abläufen zu Koordination und Kommunikation
Kommunikation ist kein Selbstzweck, sondern dient dazu, den Ablauf zu koordinieren, Fehler zu korrigieren oder Verbesserungspotenzial zu nutzen. Sie muss sich daran messen lassen, ob sie auf den Zweck der Organisation einzahlt.
Das Kondensat der Praxis und der Interaktionen: Kultur
Die Kultur einer Organisation entsteht über die Zeit aus erprobten Mustern. Sie bestimmt, was selbstverständlich ist und was nicht mehr hinterfragt wird. Sie kann helfen, den Zweck effizient umzusetzen – oder sie kann ihn untergraben.
Psychologischer Vertrag
Neben der formalen Struktur gibt es noch den psychologischen Vertrag: unausgesprochene Erwartungen zwischen Mitarbeitern und Organisation. Wenn dieser Vertrag gebrochen wird, entstehen Konflikte, die oft nicht als strukturelle Probleme erkannt werden, sondern fälschlicherweise als „zwischenmenschliche Schwierigkeiten“ gelten.
Oft wird in Organisationen auf Symptome statt auf Ursachen geschaut. Konflikte zwischen Abteilungen, ineffiziente Meetings, stagnierende Innovation – all das sind keine eigenständigen Probleme, sondern Folgen eines Missverhältnisses zwischen Zweck, Struktur und Kultur.
Wie der Zweck Klarheit in das Denken über Organisationen bringt
Wer Ordnung in das Denken über Organisationen bringen will, muss sich zuerst fragen:
1. Ist der Zweck der Organisation klar – und wird er von allen verstanden?
2. Spiegelt die Struktur diesen Zweck wider, oder gibt es Fehlkonstruktionen?
3. Sind Abläufe, Kommunikation und Kultur auf diesen Zweck ausgerichtet – oder laufen sie nebenher oder sogar dagegen?
Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, macht es Sinn, über Lösungen nachzudenken. Wer sie ignoriert und nur an Oberflächenphänomenen „herumdoktert“, schafft keine Ordnung, sondern Chaos in neuer Verpackung.
Zwischenfazit
Der Zweck ist der Ausgangspunkt für alles. Ohne Klarheit über den Zweck einer Organisation wird jedes andere Denken über Organisationen beliebig. Der Zweck ist der Kompass, der Richtung gibt. Strukturen, Abläufe, Kommunikation, Kultur und Erwartungen – all das ist nur so gut, wie es in den Zweck der Organisation einzahlt.
Wer eine Organisation verstehen will, muss sich zuerst fragen: Warum gibt es die Organisation überhaupt? Danach wird vieles einfacher.
Exkurs
Wenn man die Sache auf einer noch allgemeineren Ebene thematisieren wollte, könnte man freilich fragen, wozu Organisationen eigentlich da sind bzw. woraus sich ihr Zweck ergibt und wie.
Organisationen haben sich letztlich aus der Handlungskoordination ergeben — durch eine verbesserte Handlungskoordination kam es zu einer verbesserten Daseinsvorsorge, wuchsen die Nomadengruppen und später die Siedlungsgröße, „verdichtete“ sich die Notwendigkeit der Handlungskoordination, vergrößerten und verstetigten sich die Mechanismen zur Daseinsvorsorge, woraus irgendwann unsere heutigen Organisationen wurden. Diesen Prozess haben wir an anderer Stelle auf dieser Website ausführlich beschrieben.
„Ja, aber das meine ich nicht“, könnte der Einwand nun weiter lauten, „die Frage lautet eher: Was passiert denn, wenn Menschen auf die Idee kommen, dass eine Organisation bestimmte Werte vertreten sollte, die sie noch nicht genug vertritt? Oder was ist, wenn eine Organisation vielleicht als ‚nicht gut‘ oder sogar ‚verbrecherisch‘ eingestuft werden könnte? Wenn man, wie Sie das hier bisher machen, den Zweck der Organisation absolut setzt oder schlicht als gegeben annimmt, dann kommt man da ja gar nicht ran.“
Das stimmt, mit den bisherigen Betrachtungen kommt man da nicht ran. Um das „Wozu“ einer Organisation zu bestimmen, betreten wir den Bereich der „Ethik“ einer Organisation, und diesbezüglich kann man Prozesse und Strukturen schaffen, die den Zweck einer Organisation reflektieren, hinterfragen und ggf. neu bestimmen. Zum Beispiel kann die wirtschaftliche Lage ein Unternehmen dazu zwingen. Des Weiteren kann ein gesellschaftlicher Wandel dazu führen, wenn bspw. immer weniger junge Menschen in der betreffenden Organisation tätig sein wollen. Oder neue Gesetze können ein Unternehmen dazu bringen, seinen Zweck neu auszurichten. Aber hier handelt es sich noch nicht um „Ethik“, sondern schlicht um Zwang.
Zu einer Art Ethik könnte die Sache werden, wenn das Unternehmen Mechanismen schafft, seinen Zweck selbst zu reflektieren, zu hinterfragen und ggf. zu ändern und dafür entsprechende Regeln und Prozesse schafft — UND dies mit verschiedenen weiteren tatsächlichen und denkbaren Belangen und Interessen abgleicht. Geht es also zum Beispiel nicht mehr nur um wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch um soziale und umwelt-/nachhaltigkeitsbezogene Belange, dann wäre man beim so genannten CSR-Management, wobei CSR für Corporate Social Responsibility steht. (Ich höre schon den Protest: Was heißt hier „auch“?! Die Sache geht ja viel weiter!)
Ein Unternehmen beschäftigt sich also nicht nur selbst, sondern auch im Dialog mit anderen, mit seinem Zweck, den Auswirkungen seiner Aktivitäten auf andere und die gemeinsame Zukunft. Das wäre, was eine Organisation selbst tun könnte.
Ob eine Organisation darüber hinaus im Zweifelsfall als „nicht gut“ eingeschätzt wird, ist keine objektiv zu beantwortende Frage, weil es keine allgemeingültigen Kriterien für „gut“ oder „schlecht“ gibt. Im einfachen Fall bestimmt der Zeitgeist die weitere Entwicklung der Organisation, bspw. indem immer weniger Leute nutzen oder kaufen, was die Organisation anbietet; im komplexeren Fall kommt es zu einer langsamen Verschiebung der Werte durch den Wandel der Sichtweisen über die Generationen hinweg, und es kommt zu einem zunächst kaum zu bemerkenden Veränderungsprozess, der irgendwann auch die Bewertung der Organisation erfasst.
Man sieht dies recht deutlich am Wandel der Bedeutung mancher Institutionen: Die Kirche bedeutet heute bei Weitem nicht mehr das, was sie noch vor Jahrzehnten bedeutete — welche Ausmaße diese Veränderung hat, war vielen vielleicht nicht klar und wurde erst in der Rückschau deutlich. Wenn etwas erst in der Rückschau deutlich wird, kann man es nur noch feststellen, beeinflussen kann man das in der Regel nicht mehr. Nach unseren eigenen Erhebungen dürfte die Hälfte der Kirchenmitglieder in größeren Teilen Ostdeutschlands älter als 70 sein. Natürlich kann man darauf hinweisen, was dafür verantwortlich war: erst die Nationalsozialisten und dann die SED haben viel Kraft darauf verwandt, dem Volk den Glauben auszutreiben — was die „spitzere“ demographische Zusammensetzung der Kirchenmitglieder im Osten erklären mag. Aber der Wandel in den Köpfen durch die spätestens seit den Siebzigern im Westen und seit den Neunzigern im Osten galoppierende Individualisierung ist eine allgemeinere Dynamik, die sich nicht mehr aufhalten, geschweige denn umkehren lässt.
Bleibt schließlich noch die Frage, was man denn im Falle einer Organisation tun kann, deren Zweck „verbrecherisch“ ist. Die kurze Antwort: Da kann man als einzelne handelnde Person kaum etwas machen, das ist eine Frage, die auf der Basis von Gesetzen geklärt werden muss. Hier sieht die Gesetzgebung auch einiges vor: Beamte haben zum Beispiel das Recht zu „remonstrieren“, sie können also offiziell auf ungesetzliche bzw. nicht den Gesetzen entsprechende Anweisungen, Befehle usw. hinweisen und können die Umsetzung entsprechender Anweisungen verweigern. Zudem wurde und wird in sicherheitssensiblen Branchen wie der Luftfahrt oder in Krankenhäusern viel daran gearbeitet, die Bedingungen der Kommunikation so zu gestalten, dass man Fehler oder Verstöße ansprechen kann, ohne Furcht vor Konsequenzen haben zu müssen. Wie viele Verbesserungen man hier auch vornehmen mag — ein gewisses „Restrisiko“ ist nie auszuschließen — und neue Regelungen können im Falle ihrer Übertreibung oder „Überfeinerung“ auch „neue Monster“ hervorbringen.
Der Vollständigkeit der Betrachtungen halber sei dieser Exkurs hier kurz erlaubt gewesen — natürlich ist der eingangs skizzierte Einwand stichhaltig. Dieser Beitrag beschäftigt sich aber eben nicht mit der hier kurz umrissenen Ebene der Thematisierung des Zwecks einer Organisation an und für sich. Für die im Rahmen dieses Textes angestellten Betrachtungen verbleiben wir bei der Annahme, dass der Zweck einer Organisation (einstweilen) gesetzt ist, denn die hier zu beschreibenden Phänomene müssen erst einmal für die Ebene oder den Geltungsbereich einer Organisation plausibel gemacht werden.
Stark vereinfacht: Der Zweck einer Feuerwehr ist es, im Bedarfsfall zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen. Wir werden uns hier nicht mit irgendeiner Hinterfragung dieses Zwecks beschäftigen. Nehmen wir ein vielleicht weniger einfaches Beispiel: Ob ein Schlachthof als eine „sinnvolle Organisation“ im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang angesehen wird, oder ob dieser Zweck „unter Kritik“, wenn nicht gar „unter Beschuss“ steht, ist eine Frage, die hier nicht betrachtet wird. Hier geht es schlicht um das Verständnis von Organisationen an und für sich.
Wollte man die hier kurz erörterte Ebene ernsthaft aufmachen, müsste man bspw. die Frage nach einer „werteorientierten Organisationsentwicklung“ stellen, und diese Frage wird an anderer Stelle auf dieser Website ausführlicher diskutiert.
Das, was konkret getan wird (2)
Im Kern einer Organisation gibt es das, was konkret getan wird oder konkret abläuft: Es wird zum Beispiel etwas hergestellt. Dazu laufen Maschinen, und es gibt Menschen, die diese Maschinen bedienen. Das Ganze läuft in einer zweckmäßigen Reihenfolge ab — ein Schritt folgt dem anderen usw. In einem Krankenhaus ist es ähnlich: Jemand kommt in die Notaufnahme oder wird vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht, man erfasst die vorliegenden Informationen, dann erfolgen Anamnese und Diagnose durch das entsprechende Fachpersonal, ggf. durch mehrere Fachleute nacheinander, und schließlich kommt es zu einer Operation, Verschreibung o.ä. In manchen Organisationen muss man diesen „Kernablauf“ nicht gleich sehen, es kann auf den ersten Blick verworren zugehen — wie etwa in einer Agentur, in der jedes neue Projekt irgendwie „anders“ gehandhabt wird. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht etwa einen Kernablauf gibt: Der Auftrag kommt herein, jemand kümmert sich um den Auftrag, wobei „wer was macht und wie schnell und in welcher Reihenfolge“ stark unterschiedlich oder sogar chaotisch aussehen können, aber irgendwann gibt es Rückkopplungen zum Kunden und eine gewisse Finalisierungsphase des Projektes, und am Ende wird in der Regel eine Rechnung geschrieben. Natürlich kann es zwischendurch auch zum Abbruch oder zu Personalwechsel kommen, aber wie gesagt: das bedeutet nicht, dass es keinen Kernablauf gibt. Man muss nur danach suchen, und wenn man ihn gefunden hat und kennt, wird das Denken über die betreffende Organisation schon ein bißchen einfacher.
Das, was wir über das, was getan werden soll, besprechen, um zu koordinieren, zu korrigieren oder zu verbessern (3)
Zur Koordination der für den Kernablauf notwendigen Schritte ist Kommunikation notwendig. Kommunikation dient quasi der Handlungskoordination, sollte sich also immer darauf ausrichten, wie etwas gemacht wird, wer das macht, wozu man etwas ändern sollte usw. Zusätzlich können Fehler passieren, dann müssen diese behoben werden. Vielleicht hat auch jemand eine Idee, wie ein bestimmter Schritt besser funktionieren könnte. Alle drei Erfordernisse — die einfache Handlungskoordination, der Umgang mit Fehlern oder die Abwägung von Ideen — machen deutlich, wie abhängig der Erfolg der Schrittabfolge von gelingender Kommunikation ist.
Nun gibt es hier ein verbreitetes Missverständnis: In vielen Organisationen werden Probleme zwischen einzelnen Personen oder Probleme in Teams als „Kommunikationsprobleme“ behandelt. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Kommunikation ein „Problem an und für sich“ sein könnte; dadurch erhält die Kommunikation unbeabsichtigt oft den Nimbus eines „Zwecks an sich“, den sie aber nicht hat. Kommunikation in Organisationen ist immer abhängig vom Zweck der Organisation, ergibt ihren Sinn nur in ihrer Ausrichtung auf diesen Zweck. Jetzt kommt es quasi darauf an, woraus sich der Konflikt ergibt: Sind sich zwei handelnde Personen vielleicht „unsympathisch“, oder ist die eine Person sehr offen und innovativ und geht sehr großzügig mit Fehlern um, und ist die andere Person vielleicht sehr genau und will ihre Aufgaben möglichst richtig erledigen und kontrolliert deshalb viel — dann ergibt sich der Konflikt eher aus Persönlichkeitsmerkmalen. Haben die betreffenden beiden Personen jedoch Rollen, aus denen sich jeweils ergibt, aus dieser oder jener Perspektive auf eine Sache zu blicken, dann ergibt sich der Konflikt aus den Rollen.
Oft genug ist es eine verworrene Mischung: Bestimmte Persönlichkeiten suchen sich Aufgaben/Rollen, die ihnen entsprechen, dazu kommen Sympathie, Grüppchenbildung und die Frage, wie gut man sich kennt, und wie sicher man sich fühlt, dem Gegenüber die eigene Meinung mitzuteilen, wie sehr das „erwünscht“ und möglich ist, oder ob es dafür was auf den sprichwörtlichen „Deckel“ gibt o.ä. Es gilt also, bei der Kommunikation (a) zu berücksichtigen, warum und wozu kommuniziert wird (Handlungskoordination, Zweck der Organisation) sowie (b) zu klären, inwiefern es sich um persönlichkeits- oder sympathiegetriebene Faktoren einerseits oder aufgaben- bzw. rollenbezogene Faktoren andererseits handelt.
Hat man das auseinandergelegt und analysiert, handelt es sich nicht mehr nur um ein allgemeines, irgendwie „wolkiges“, unspezifisches „Kommunikationsproblem“, sondern um einen beschreibbaren Konflikt auf entweder persönlicher oder aufgabenbezogener Ebene, oder es handelt sich um eine Mischung aus beiden, aber dann wird eben diese „Mischung“ seziert und getrennt voneinander „kartiert“, beschrieben und analysiert.
Die Rollen ergeben sich aus dem Zweck der Organisation; Rollen sind gewissermaßen „Erwartungsbündel“ und damit in der Regel ganz gut beschreibbar — oder es wird eben klar, dass die Aufgabenbündel nicht klar genug definiert, abgegrenzt oder was auch immer sind. Wichtig ist, dass die Sache „beschreibbar“ und damit „klar“ wird.
Nun ist es wahrscheinlich mit einer simplen Erinnerung daran, wozu man eigentlich verpflichtet ist, selten getan (wie etwa im Eingangsbeispiel). Vielen Menschen fällt es leicht, persönliche Animositäten in die Gestalt fachlicher Kritik zu kleiden und damit zu tarnen. Zwar handelt es sich bei der Kommunikation, wie soeben dargestellt, keineswegs um einen „Zweck an und für sich“ — die Relevanz der Kommunikation ist gegenüber dem Zweck der Organisation vielmehr nachrangig. Es gibt also eine gewisse Verpflichtung zur Kommunikation, wenn sich dies aus der Rolle bzw. den Aufgaben der handelnden Personen ergibt.
Verpflichtung hin oder her — eine simple „Ansage“ oder gar ein „Verdonnern“ hat noch selten oder nie zu gelingender Kommunikation und schon gar nicht zu der Bereitschaft geführt, sich einen Kopf zu machen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Also sind wir immer noch und vor allem abhängig von der Bereitschaft der Beteiligten zu gelingender Kommunikation. Hinzu kommt, dass in den meisten Branchen die „technischen Faktoren“ so gut wie „durchoptimiert“ sind, und Erfolg, Effizienzgewinn und Marge immer abhängiger vom menschlichen Faktor geworden sind.
Mag also theoretisch der Zweck der Organisation über allem thronen, entscheidet sich das konkrete Gelingen eben doch an der ganz praktischen Kunst, die Beziehungen so zu gestalten, dass Kommunikation funktioniert. Wie das geht oder gehen könnte, haben wir kürzlich ausführlicher thematisiert.
Kurz zusammengefasst: Gelingende Kommunikation ist abhängig von entsprechenden Beziehungen unter den handelnden Personen; diese Beziehungen wiederum sollten von einem Mindestmaß an Vertrauen oder mindestens Zutrauen in die Kompetenz des Gegenübers gekennzeichnet sein. Hier kommt es auf die Haltung an: Interessiert mich, wie mein Gegenüber die Sache sieht, und stelle ich entsprechende Fragen? Oder bin ich in einem Modus des „Mitteilens“ oder „Diskutierens“? Ganz kurz auf den Punkt gebracht, lautet die wichtigste Regel: „Nicht diskutieren, Fragen stellen.“
Will man von außen helfen, Kommunikationsprobleme zu klären, sind u.a. folgende Fragen hilfreich: „Was haben Sie mit Ihrem Gegenüber erlebt?“ oder: „Wie funktioniert Ihre Zusammenarbeit?“ oder: „Was hat Sie verletzt?“ folgen eben Fragen wie: „Was soll eigentlich bei Ihrer Kommunikation herauskommen?“ oder: „Was war ggf. Ihr eigener Anteil an der Eskalation?“ und: „Gibt es vielleicht etwas, für das Sie sich entschuldigen möchten oder sollten?“ oder: „Was wünschen Sie sich?“ oder: „Was wäre für eine gute Kommunikation notwendig — vom Gegenüber und von Ihnen selbst?“ und: „Wenn Sie sich einmal vorstellen, was optimal wäre im Sinne dessen, was hier konkret herauskommen soll, also wofür diese Organisation eigentlich da ist, was würden Sie da sagen, wie Ihre Kommunikation aussehen sollte?“ und: „Was könnten Sie persönlich dafür tun, was wäre Ihr erster Schritt?“
Wie sich die Struktur aus dem Zweck der Organisation ergibt (4)
Aus dem Zweck der Organisation heraus lässt sich bestimmen, wozu es die Organisation gibt und welche Leistungen bei welchen Anlässen und unter welchen Voraussetzungen usw. erbracht werden sollen. Hieraus wird klar, was die wesentlichen Schritte zur Erbringung eben dieser Leistungen sind, woraus wiederum klar wird, welche „Aufgabenbündel“ es gibt, die von Menschen erfüllt werden sollen. Letztlich lässt sich also die wesentliche Struktur der Organisation aus dem Zweck ableiten.
Was in einem Unternehmen selbstverständlich ist und nicht hinterfragt werden kann (5)
Die dritte Ebene, an die man denken kann, wenn es darum geht, die Geschehnisse in einem Betrieb oder jeder anderen Organisation zu verstehen, ist der „Besitz der Gruppe“. Das sind jene Dinge, welche von den Angehörigen einer Organisation für selbstverständlich gehalten werden — sie sind irgendwann einmal entstanden, wobei nicht mehr zwingend klar sein muss, wie diese Dinge entstanden sind. Man muss sich das im Groben so vorstellen: Irgendwann hatte jemand eine Idee und war mit dieser Idee so erfolgreich, dass ein Unternehmen oder eine andere Organisationsform daraus wurde. Am Anfang waren die beteiligten Menschen vielleicht neu, da waren die genauen Vorgehensweisen noch unklar, aber mit der Zeit und bei bleibendem Erfolg wurden aus den Vorgehensweisen langsam Muster, später Gewohnheiten.
Gewohnheiten werden in der Regel nicht mehr hinterfragt — und diese Dinge werden an neue Organisationsmitglieder weitergegeben. Wenn nun jemand kommt und eine Idee hat, dass man etwas ändern könnte, entstehen bereits die ersten Konflikte nach dem Motto: Nein, das haben wir noch nie so gemacht. Mit der Zeit „kondensieren“ die aus den Vorgehensweisen entstandenen Gewohnheiten zu Regeln und Werten, die unbewusst mit bestimmten Annahmen über die Welt und wie sie funktioniert, einhergehen. Ob man zum Beispiel jede andere Person im Unternehmen alles fragen kann, ob die Chefin mit jedem beliebigen Mitarbeiter am Tisch sitzen würde, ob man seine Meinung offen sagen kann, weil man darum gebeten wird, oder ob man seine Meinung lieber für sich behält, weil man nie genau weiß, welche Folgen das haben kann, ob man gefragt wird, wenn es um eine Sonderschicht geht, oder ob es selbstverständlich ist, das einfach zu machen, wenn man angerufen wird, usw. — am Anfang einer Organisation waren diese Dinge noch recht offen, später bildeten sich daraus Selbstverständlichkeiten, die sich in Annahmen über den Menschen und den Umgang mit dem Menschen niedergeschlagen haben.
Gemeinhin werden diese Selbstverständlichkeiten bzw. wird der „Besitz der Gruppe“ als „Organisationskultur“ bezeichnet. In einem Team kann es eine bestimmte „Kultur“ geben, das heißt, in einem Team können andere Selbstverständlichkeiten gelten als in einem anderen Team (bspw. dass die Chefin auch mal laut werden kann vs. dass das „gar nicht geht“). Eine Abteilung kann diesbezüglich anders „ticken“ als eine andere Abteilung — und so weiter: Diese jeweiligen „Gruppierungen“ von Selbstverständlichkeiten oder „Prototypen“ von Merkmalsanordnungen setzen sich auf allen denkbaren Ebenen fort. So gibt es bspw. die Kultur eines spezifischen Unternehmens, bestimmte Kulturmerkmale der Branche oder bestimmte „Selbstverständlichkeiten“, die sich aus dem Berufsbild ergeben (bspw. „BWLer“ vs. „Ingenieure“). Das geht dann weiter über Regionen, Länder, Nationen, Sprachräume, Kulturräume usw., aber diese Ebenen stehen hier nicht zur Debatte.
Das Denkmodell
Jetzt nehmen Sie bitte alle bisher beschriebenen Elemente zu einem Denkmodell zusammen. Wenn Sie die dargestellten Elemente und Ebenen zu einem Denkmodell integrieren, lassen sich in Anwendung auf verschiedene Beispiele und damit verbundene Fragen jeweils spezifische Erkenntnisse ableiten. Ein Beispiel in Anwendung auf das eingangs dargestellte Beispiel:
Da es sich bei den handelnden Personen um Menschen handelt, die eine individuelle Persönlichkeit und individuelle Vorerfahrungen besitzen, wird deutlich, dass nicht von einer immer gleichen Erfüllung der Aufgaben ausgegangen werden kann — die Persönlichkeit (bspw. sicherheitsorientiert vs. kreativ; zurückhaltend vs. tonangebend usw.) spielt beim Ausfüllen einer Rolle immer mit. Hinzu kommt das Ausmaß an Erfahrung. Man kann den Zweck einer Organisation also darstellen und erwarten, dass sich die Person bemüht, auf den Zweck einzuzahlen. Man wird hier aber immer mit Unterschieden leben müssen. Die Aufgabe von Führungskräften besteht also unter anderem darin festzustellen, ob es sich (vor dem Hintergrund des „Einzahlens“ auf den Zweck der Organisation) um eine „hinreichende“ oder sogar „gute“ oder eben eine „entwicklungsbedürftige“ Erbringung der erwarteten Leistungen handelt (das hierzu hilfreichste Modell ist das des „psychologischen Vertrags“, das wir u.a. hier ausführlicher und in Anwendung auf Mitarbeitergespräche dargestellt haben).
Ausgehend von dem insgesamt hohen technischen Entwicklungsstand in unseren Organisationen ist davon auszugehen, dass die Fehlerquellen hauptsächlich im Bereich der „menschlichen Faktoren“ zu suchen sind. Nehmen wir hinzu, dass unser durchschnittliches Ausbildungslevel ebenfalls recht hoch liegt, verweist das umso mehr auf den Umstand, dass es kaum an der Technik und vergleichsweise selten an Inkompetenz liegt, sondern eher an dem Zusammenhang, der sich aus der Interaktion zwischen den handelnden Personen ergibt.
Natürlich können Kompetenzdefizite nicht ausgeschlossen werden; freilich kommt das vor — aber dann muss das eben festgestellt werden, und dann ist relativ klar, was zu machen ist.
Noch klarer ist es im Falle technischer Probleme: In der Regel ist schnell klar, dass es technische Probleme gab, wenn es welche gab. Dann ist auch klar, dass die menschliche Ebene keine Rolle gespielt hat.
Besonders kompliziert sind Probleme jedoch dann, wenn sich die Ursache aus einer Mischung aus technischen und menschlichen Faktoren ergibt, wenn etwa Bedienfehler zur Ursache für Unfälle werden, weil die Bedienungsgrundlage nicht eindeutig und/oder selbsterklärend war, wenn also etwa die Schalter für zwei völlig unterschiedliche Funktionen der Anlage völlig gleich aussehen und die Markierung nur klein und ikonisch ist, sich aber eben nicht in der Gestalt des Schalters niederschlagen und ich das trotz guter Ausbildung in einer extrem stressigen Situation nicht mehr unterscheiden kann. In solchen Fällen interagieren menschliche mit technischen Faktoren, aber die Lösung ist hier vor allem technischer Natur, auch wenn der Weg dahin manchmal lang sein mag. Das „Gros“ der Probleme wird aber, so möchten wir behaupten, in der Regel von der Kommunikationsebene kommen, eben weil die technische Seite des Geschehens in der Regel weitestgehend „durchoptimiert“ ist.
In Bezug auf das eingangs geschilderte Beispiel wäre zu fragen, ob die unterschiedlichen Einlassungen zu den Einstellungen der Prodiktionslinie an Unterschieden im Wissen, an unterschiedlichen Prioritäten oder Interessen oder schlicht an den Problemen auf der Kommunikationsebene gelegen haben. Die Analyse in dem konkreten Fall hat ergeben, dass es nicht am Wissen lag, wohl aber an fehlender Abstimmung. Aus der fehlenden Abstimmung resultierte dann, dass unterschiedliche Prioritäten gesetzt und dementsprechend unterschiedliche Einstellungen vorgenommen wurden. Das Problem lag aber eindeutig auf der Beziehungsebene: mangelnder Respekt oder mangelndes Zutrauen in die Kompetenz des jeweils anderen führten zu der Ansicht, dass die eigene Sichtweise richtiger war als die andere. Insofern handelte es sich einfach nur um ein Status-Problem: Mangelnde Anerkennung des anderen führten zu einer Verweigerung, mit dem anderen zusammenzuarbeiten usw.
Man kann die Analyse des Problems sicher fortsetzen und vertiefen. Aus Gründen der Lesbarkeit des Textes sei hier auf eine weitere Vertiefung verzichtet — Sie können ein Beispiel aus ihrer eigenen Erfahrung hernehmen und durch die „Brille“ dieses Textes analysieren.
Am Ende des Textes sei noch auf zwei notwendige weiterführende Fragen hingewiesen. Bisher haben wir uns ja eher mit der Frage der Analyse und des Verständnisses organisationaler Probleme beschäftigt. Folgende Fragen sind weiterführend wichtig:
Wie wird klar, in welche Richtung sich eine Organisation entwickeln kann oder soll? Hier sind natürlich zunächst und vor allem die entscheidenden Akteure relevant: Wo wollen sie hin? Was ist die „Zone der nächsten Entwicklung“ der Organisation?
Aber auch die Forschung gibt hier einigen Aufschluss:
Was unterscheidet eine effiziente Organisation von einer weniger effizienten, und was hat das mit Kommunikation und Beziehungsgestaltung zu tun? (Jody Hoffer Gittell)
Wie kann eine Organisation neue Routinen erlernen, und was passiert, wenn sie in den alten Routinen stecken bleibt? (Amy Edmondson)
Wie kann ich als vorgesetzte oder als beratende Person Beziehungen gestalten, welche Haltungen sind dafür notwendig, und welche Techniken sind dabei hilfreich? (Edgar Schein)
Es ist allerdings auch hilfreich zu wissen, warum das Intendierte oft nicht klappt (auch wenn alle Beteiligten zustimmen). Hier handelt es sich um Abwehrmechanismen (oder, anderer Begriff: defensive Routinen). Es lohnt sich, die diesbezüglichen Texte von Chris Argyris zu lesen.
Wie eine Moderation in einer konflikthaften Weiterentwicklungssituation hilfreich sein kann bzw. welche Haltungen und Techniken dafür notwendig sind, können Sie hier nachlesen.