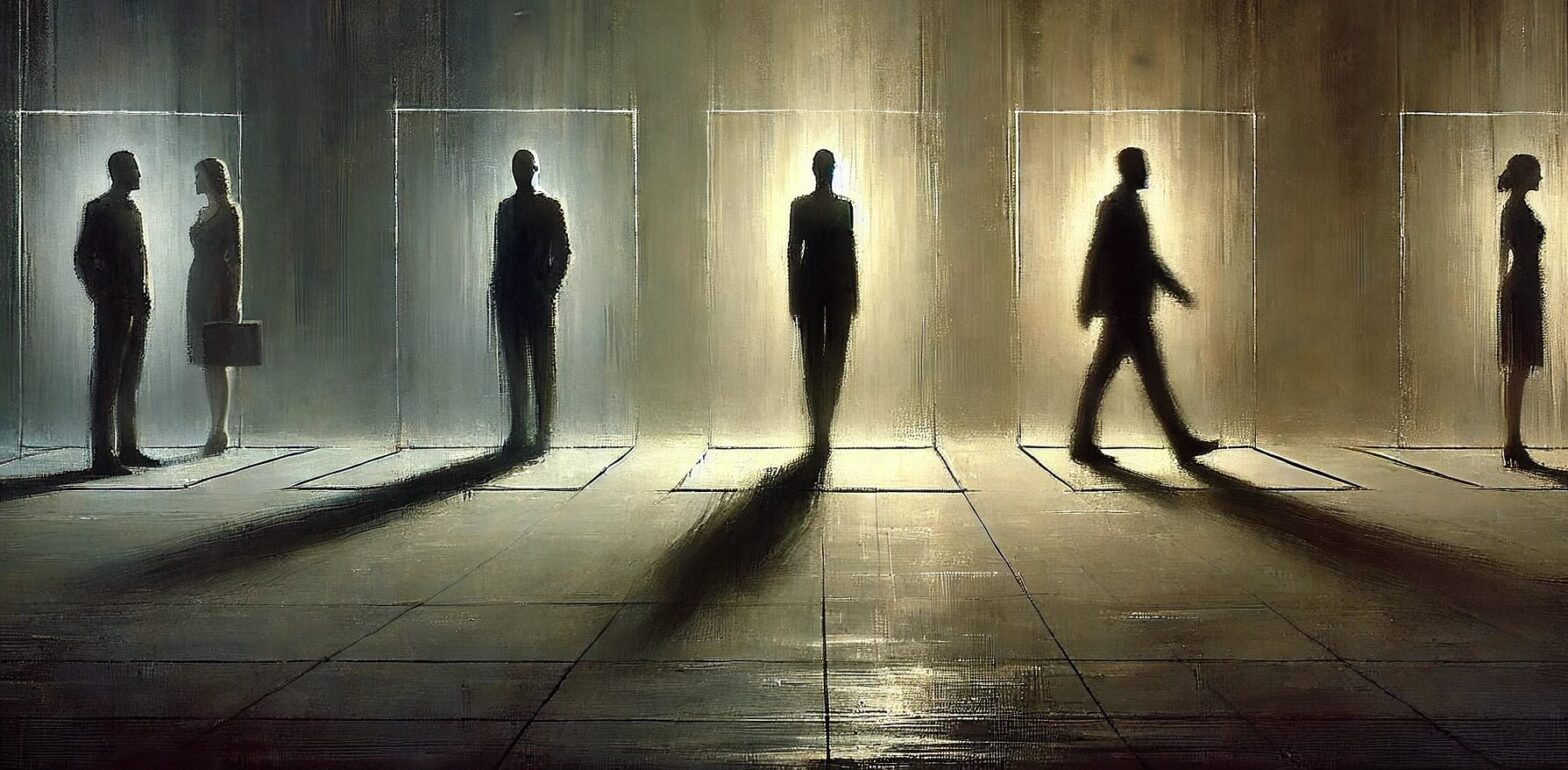Die Aufgabe einer Führungskraft ist klar: Sie muss dafür sorgen, dass die Handlungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Zweck der Organisation einzahlen. Dafür braucht es Kommunikation, klare Erwartungen und eine aktive Auseinandersetzung mit Problemen. Doch in der Praxis sind Wille und Umsetzung oft verschiedene Dinge.
Es gibt drei Wege, mit Problemen umzugehen – aber nur einer davon führt zuverlässig zu einer Verbesserung, die anderen beiden Wege sind jeweils riskant.
Die Strategie des Abwartens
Viele Führungskräfte entscheiden sich bewusst oder unbewusst für eine Strategie des Abwartens. Sie tun zunächst wenig, beobachten die Entwicklung und hoffen darauf, dass sich das Problem irgendwie von selbst löst. Diese Haltung ist weit verbreitet. Sie bringt jedoch zumeist keine Verbesserung, sondern führt dazu, dass sich die Situation zuspitzt.
Am Ende steht oft genug Pflichtverwahrlosung — ein Zustand, in dem Führungskräfte sich nicht mehr zuständig fühlen, Verantwortung ablehnen und das System sich selbst überlassen. Was dann passiert, beschreibe ich ausführlich in diesem Artikel.
Kurz zusammengefasst: Pflichtverwahrlosung beginnt schleichend – durch Vermeidung von Entscheidungen, durch das Ignorieren von Konflikten. Die Folge: Prozesse werden nicht mehr gesteuert, sondern nur noch reaktiv verwaltet. Langfristig entsteht eine „Kultur der Beliebigkeit“, in der sich niemand mehr wirklich verantwortlich fühlt. Die Strategie des „Aussitzens“ ist also keine Handlungsstrategie, sondern bedeutet oft einen schleichenden Kontrollverlust.
Der freundliche Weg – Probleme ansprechen, aber mit System
Wer aktiv etwas ändern will, kann das Problem direkt ansprechen – allerdings mit Bedacht. Proaktive Führung entfaltet nur dann Wirkung, wenn sie drei zentrale Prinzipien berücksichtigt:
Hartnäckigkeit: Es reicht nicht, ein Problem einmal zu benennen. Wer Veränderungen bewirken will, muss die Botschaft immer wieder wiederholen.
Geduld: Menschen ändern ihre Gewohnheiten nicht sofort. Selbst in einem Kindergarten muss eine neue Regel mindestens 25–30 Mal wiederholt werden, bevor sie zur Gewohnheit wird. Um etablierte Muster bei Erwachsenen zu verändern, braucht es ein Vielfaches davon.
Gute Laune: Wer proaktiv handelt, aber dabei gereizt oder ungeduldig wirkt, erzeugt Widerstand. Proaktives Verhalten ohne gute Laune führt dazu, dass man als „Nervensäge“ oder gar als „Empörungsbeauftragter“ wahrgenommen wird.
Entscheidend ist also die richtige Haltung: Wer auf Veränderung drängt, sollte sich fragen, ob er das mit Entspanntheit und Souveränität tut, oder ob er sich selbst emotional schon im „Eskalationsmodus“ befindet — denn das beeinflusst, wie die Botschaft aufgenommen wird.
Die klare Ansage – Ultima Ratio der Führung
Der dritte Weg ist die direkte Konfrontation. Es gibt Momente, in denen eine klare Ansage unumgänglich ist. Dieser Weg hat jedoch eine hohe „Eintrittsschwelle“: Eine Konfrontation kann nicht mehr zurückgenommen werden. Nach einer Eskalation gibt es keinen sanften Übergang zurück in den Dialogmodus. In der Regel hat eine klare Ansage Konsequenzen – entweder für die betroffene Person oder für das eigene Verhältnis zum Team. Wer diesen Weg wählt, sollte sicher sein, dass es keine Alternativen mehr gibt.
Fazit: Die klare Ansage ist das schärfste Instrument einer Führungskraft. Setzt man es zu früh oder zu oft ein, verliert es seine Wirkung.
Wann welcher Weg sinnvoll ist
Wer ein Problem ignoriert, verlängert nur den Zeitraum bis zur Eskalation. Pflichtverwahrlosung beginnt mit der Unterlassung von Entscheidungen.
Der freundliche Weg ist der effektivste Ansatz, um Veränderung nachhaltig herbeizuführen. Dabei gilt es, Probleme zu benennen, aber mit Wertschätzung und Ruhe. Es gilt, die Erwartungen oft zu wiederholen. Dazu braucht man gute Laune. Man muss „gut gelaunt dranbleiben“, um nicht zu viel Widerstand hervorzurufen.
Die klare Ansage bleibt das letzte Mittel. Sie sollte nur dann genutzt werden, wenn andere Wege ausgeschöpft sind. Wer sie zu oft verwendet, ruiniert sein Standing als Führungskraft.
Und: Klare Ansagen müssen mit Konsequenzen „bewaffnet“ sein — wer mit Konsequenzen droht, muss sich auch sicher sein, sie verwirklichen zu können.
Letztlich geht es nicht darum, „nett“ zu sein oder „hart durchzugreifen“, sondern es geht um Wirksamkeit. Also müssen die Führungshandlungen „wohltemperiert“ sein. Führung bedeutet, die Dinge in Bewegung zu bringen.