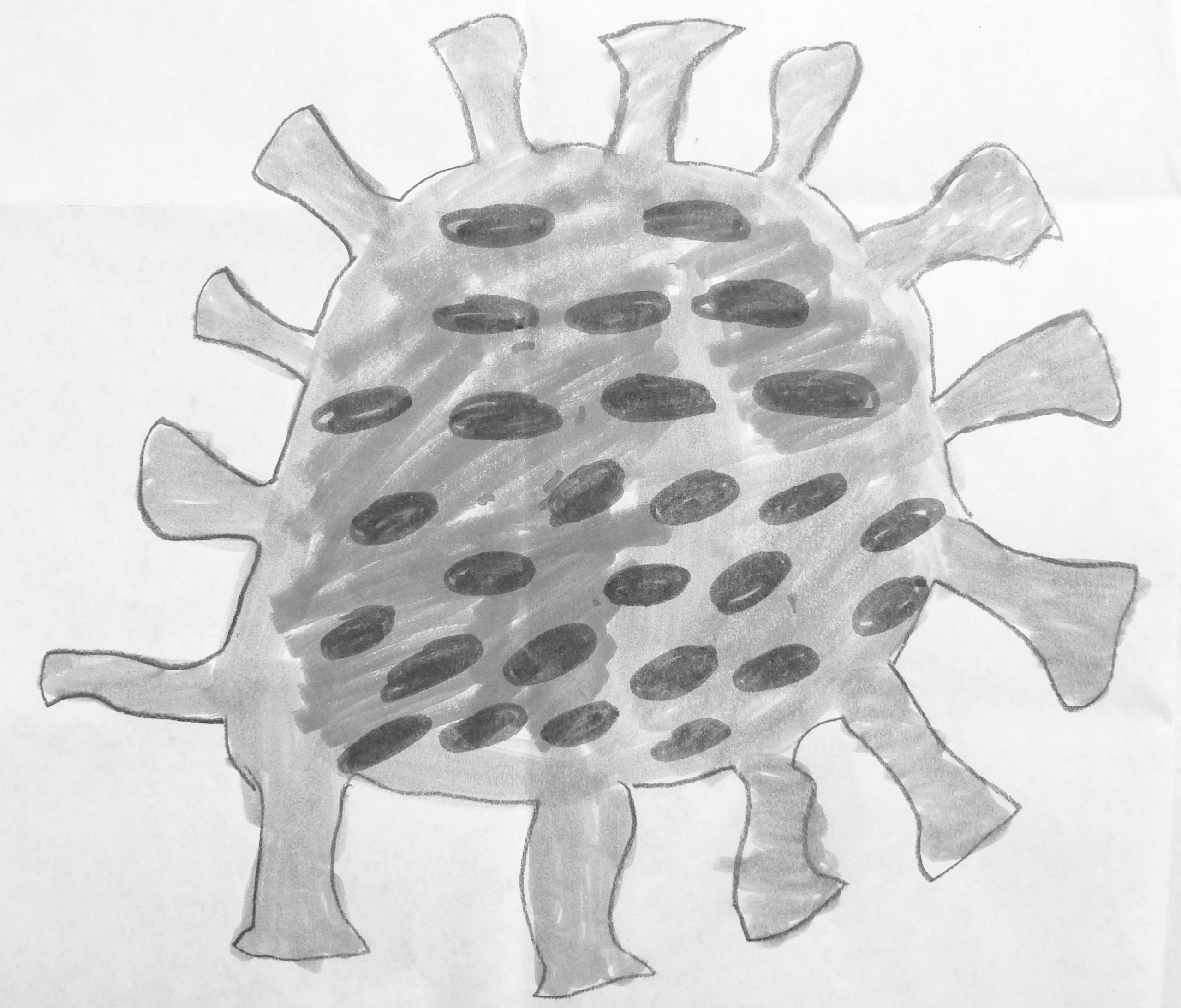Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor der ersten Corona-Welle? Damals wusste kaum jemand genau, was auf uns zukommt. Entsprechend unsicher war die Lage, und was getan wurde, entsprach im besten Sinne einer Krisenreaktion.
Heute kennen wir das Virus besser und wir ahnen nicht nur, sondern wir wissen, dass, wenn es sich unkontrolliert ausbreitet, mehr Menschen sterben, als wenn wir die Ausbreitung halbwegs im Griff behalten.
Es sei denn, man bezweifelte die Existenz des Virus’ oder hielte es für eine schlichte Grippe — was, wenn man auf dem Boden der verfügbaren Fakten bleibt, mittlerweile als widerlegt gelten sollte. Wenn man hingegen den verfügbaren „alternativen Fakten“ zum Thema folgt, führt das in ein kommunikatives Dilemma, aus dem man nicht mehr herausfindet. COVID-19 ist weder eine Grippe, noch ist es die Pest; es trifft eine Mehrzahl kaum oder nicht besonders hart, aber diejenigen, die es „richtig erwischt“, trifft es hart (schwerer Verlauf und/oder Langzeitfolgen) oder final (tödlich).
Gleichzeitig wissen wir aber auch, was ein Lockdown kostet — wie entsetzlich hoch der Preis war. Ganze Branchen sind unter Druck geraten, vielen Familien und vor allem Kindern hat die lange Zeit auf engem Raum und ohne Schule bzw. sozialen Austausch nicht gut getan. Viele Selbständige und kleine Unternehmen sind nach wie vor angeschlagen oder in ihrer Existenz bedroht. Im kommenden Jahr werden wir zudem sehen, wie sich die Suizidrate entwickelt hat und welche Langzeitfolgen zu verzeichnen sind. Aber so ist das mit Krisenreaktionen: Die Kosten sind sehr hoch und die Folgen nicht unbedingt kalkulierbar.
Die Krisenreaktion erfolgte damals vergleichsweise umfassend und schnell — immerhin wurde ein ganzes Land weitgehend angehalten! Heute wird langsamer und regionaler reagiert. Die Gesundheitsämter sind die Dreh- und Angelpunkte der Maßnahmen, die Länder und der Bund beschränken sich auf Leitlinien, was letztlich zu einiger Verwirrung ob des Flickenteppichs aus unterschiedlichen Regelungen und Maßnahmen führt.
Diese beiden unterschiedlichen Reaktionsweisen auf ansteigende Infektionszahlen — der umfassende Lockdown am Anfang und die jetzige regionalere und reaktivere Vorgehensweise — erfordern verschiedene Grade individueller Verantwortung. Durch einen generellen Lockdown wird dem Individuum die Verantwortung weitgehend abgenommen. Bei der aktuellen Regelung kommt es hingegen umso mehr auf die individuelle Verantwortung an — ich muss selbst entscheiden, ob ich eine Reise antrete, eine Feier besuche, mich mit Freunden treffe usw.
Etwas zugespitzt könnte man es so formulieren: Wir üben jetzt, wie das „schwedische Modell“ bei uns funktionieren könnte. Wir setzen dabei auf einen Lernprozess bei jeder und jedem Einzelnen — und das bei deutlich höheren täglichen Infiziertenzahlen als im März zu Beginn des ersten Lockdowns.
Das Paradoxe an der aktuellen Situation ist, dass die individuelle Bereitschaft, Maßnahmen zu akzeptieren, sich an Regeln zu halten und in eine Art kollektiven Lernprozesses einzuwilligen, in Verbindung mit dem Unsicherheitsgefühl während der ersten Welle viel höher war als jetzt.
Das bedeutet im Grunde, dass die Verantwortungsbereitschaft während des Lockdowns im Frühjahr viel höher war als heute, während die Verantwortungsnotwendigkeit viel geringer war als jetzt — und dass es heuer umgekehrt ist: die individuelle Verantwortungserfordernis ist heute viel höher als seinerzeit, während die Verantwortungsbereitschaft zu wünschen übrig lässt.
Nachher ist man immer schlauer, könnte man sagen.
Der Preis für einen kollektiven Lernprozess wäre während der zweiten Welle mindestens genauso hoch, wahrscheinlich aber viel höher, als er während der ersten Welle gewesen wäre, wenn wir gleich auf individuelle Verantwortung gesetzt hätten. Und freilich würde ein solcher Lernprozess wesentlich mehr direkte Opferzahlen fordern als ein Lockdown.
Die seit dem Lockdown zu verzeichnenden Gewöhnungseffekte und eine verminderte Bereitschaft, sein Leben noch einmal stärker einzuschränken, bewirken aber, dass der Lernprozess nun wahrscheinlich sehr lang wird.
Wird der Lernprozess „politisch gefühlt“ zu lang, führt das sehr wahrscheinlich direkt in einen weiteren Lockdown, denn ein „Durchmarsch“ des Virus hätte — wahrscheinlich tatsächlich, mindestens aber in den Augen der handelnden Personen — noch unabsehbarere Folgen als ein weiterer Lockdown.
Insofern beißt sich die sprichwörtliche Katze in den Schwanz: Die eigentlich notwendige ethische Diskussion — eine Abwägung zwischen mehr kurzfristig zu rettenden Leben (Lockdown) und längerfristiger Senkung der Ansteckungsrate UND Vermeidung langfristiger negativer Folgen eines Lockdowns unter Inkaufnahme einer mittelfristig höheren Todesrate (kollektiver Lernprozess) — wird, so steht zu befürchten, angesichts der momentan zu beobachtenden dramatischen Zuspitzung der Lage nicht geführt.
Wenn diese Annahme nicht falsch ist und es also bald zu einem weiteren Lockdown kommt, hätte das — neben der positiven Wirkung in Gestalt geringerer Todeszahlen und allen bereits bekannten negativen „Nebenwirkungen“ eines Lockdowns — ziemlich sicher einen weiteren unerwünschten Effekt, nämlich einen „indirekten Lerneffekt“ bei politischen Entscheidungsträgern: dass der deutschen Bevölkerung außer mit strikten Vorgaben von oben kaum beizukommen ist.