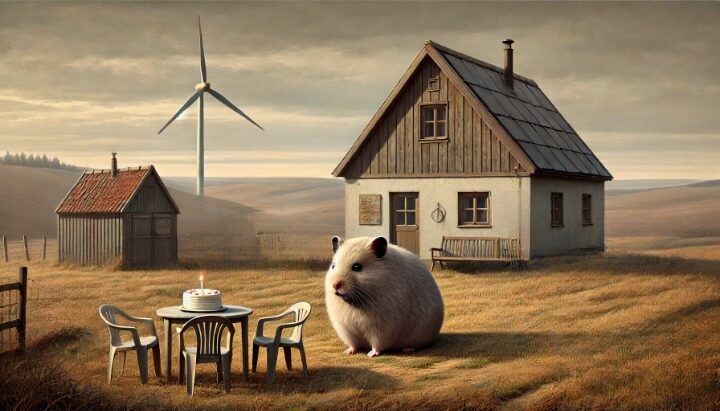Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen steht zu erwarten, dass der Anteil narzisstisch geprägter Persönlichkeiten in den Belegschaften steigt. Mit diesem Beitrag wird versucht, diese Entwicklungen zu beschreiben und Antworten auf die Frage zu geben, wie Führungskräfte mit dieser Entwicklung umgehen können. Die Antworten werden vielen Leserinnen und Lesern womöglich zu vage bleiben. Es sei deshalb angemerkt, dass es sich bei dem Text um eine erste, stellenweise „spitze“ und hier und da auch „augenzwinkernde“ Annäherung handelt. Zudem könnte es sein, dass sich manche Leserinnen oder Leser an dem ggf. zu unkritischen Ton stören, mit dem der Umgang mit einem wachsenden Anteil narzisstisch geprägter Persönlichkeiten in den Belegschaften beschrieben wird. Der Text folgt der Annahme, dass narzisstische Verhaltensweisen nicht durch Benennen oder gar Anprangern verschwinden, im Gegenteil. Und wenn, wie hier dargelegt wird, während Narzissmus ständig und auf breiter Front kritisch betrachtet wird, der Narzissmus-Index der gesamten Gesellschaft unbemerkt steigt, dann kann man zwar in die allgemein vernehmbare Kritik einstimmen, behält das Problem des konkreten Umgangs aber trotzdem auf der Agenda. Also erscheint die Frage nach dem funktionierenden praktischen Umgang hilfreicher, als nur die allseits bekannten Darstellungen der negativen Effekte zu wiederholen. Ein Risiko allerdings bleibt: Man ist, so gut man auch darin sein mag, einen funktionierenden Umgang zu finden, nie vor dem nächsten „Blitz“ geschützt. Und nach so und so vielen solchen Blitzen kann sich der geduldige Umgang wie Gesichtsverlust oder Unterwerfung anfühlen. Keins der hier beschriebenen Handlungsmuster hilft in allen Fällen, und keines hilft für immer. Manchmal ist es sogar wirksam, einen gezielten „Konterblitz“ loszulassen. Manche Leute nehmen einen erst ernst, wenn man ihnen bewiesen hat, dass man es auch „blitzen“ lassen kann.
Trauma und Narzissmus
Narzissmus ist, von der Ursache her betrachtet, kein Charakterfehler, sondern eine Überlebensstrategie, und zwar eine, die sich früh bildet. Ein Kind erlebt Situationen, die es überfordern. Man kann sich das etwa so vorstellen:
- Entweder war es in der frühen Kindheit zu kalt, zu distanziert — es kann auch in der späteren Kindheit zu gewaltsam zugegangen sein; ein Kind kann seine Eltern ja nicht nicht lieben, es geht immer wieder hin, auch wenn es Gewalterfahrungen machen muss.
- Oder es war viel zu viel Liebe, Umarmung, Behütung — aber nicht wegen des Kindes, sondern weil andere denken sollten, dass man alles richtig macht, die beste Mama der Welt ist — und weil das Kind genau das später auch bestätigen soll, oft sogar muss.
Die Folge ist in beiden Szenarien (vernachlässigende Kälte vs. manipulative Überbehütung) die gleiche: das Kind zieht sich zurück. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Es nimmt die Verbindung zu seinen Gefühlen gleichsam „vom Netz“. Das ist ein Selbstschutz, der zunächst überlebenswichtig ist – und später zerstörerisch wirken kann.
Ein Trauma ist kein Ereignis. Es ist eine Reaktion. Das Ereignis ist das, was die Reaktion auslöst. Es kann ein singuläres Ereignis sein oder etwas, das man „langanhaltendes Grauen“ nennen könnte. Ein kleines Kind kann nicht fliehen, so etwas würde einem Kind kaum einfallen, und wer als Kind nicht fliehen kann, muss innerlich verschwinden. In diesem Rückzug liegt die Saat des Narzissmus.
Ein narzisstisch geprägter Mensch hat das Fühlen verlernt, weil zu fühlen irgendwann einmal zu schrecklich war. Er hat gelernt, sich selbst zu beobachten, statt sich selbst zu spüren. Er hat sich ein Ersatz-Selbstbild gebaut, das er verteidigt, weil das echte Selbst zu verletzlich ist.
Solche Menschen wirken stark, erfolgreich, oft charmant. Aber innen… fühlen sie sich leer. Innen sitzt ein kleiner Mensch mit sieben Hüten in einem Kristallpalast. Hüte mit Aufschriften wie: „Ich bin besonders“, „Ich bin unersetzlich“, „Ich bin die beste Mutter“, „Ich bin die Klügste“, „Ich habe die schönste Freundin“, „Ich bin der hilfreichste Sozialarbeiter“, „Ich habe die meiste Erfahrung“ o.ä. Aber keiner dieser Hüte wärmt. Keiner schützt. Die Hüte (oder: Masken, Mäntel, Ersatz-Selbstbilder) verdecken nur den Schmerz.
Außen steht der erfolgreiche, liebenswerte, charmante, bewundernswerte, überaus engagierte usw. Mensch und bewacht seinen Kristallpalast — und belegt jede und jeden mit „prophylaktischen Eskalationen“, die oder der dem hübschen, aber eben fragilen Palast gefährlich werden könnte. Nahe kommen geht nur, wenn sich das Gegenüber blenden lässt — oder den Eindruck der Blendung glaubhaft aufrecht erhält. Wenn man so nah kommen darf, dass man hineingelassen wird, wird man durch die Galerie mit den „sieben Hüten“ geführt. Nur in das eine Zimmer dort hinten in der Ecke, dort darf man nicht hinein. Und wehe, man versucht, dennoch hineinzublicken.
Narzisstisches Verhalten ist deshalb oft kühl, berechnend, schnell wechselnd. Weil es nicht ums Gegenüber geht, sondern um Selbstschutz. Ein Narzisst kann sich trennen, ohne zu fühlen. Eine Narzisstin kann ohne Bindung lieben. Sie kann ohne Nähe helfen. Aber was wie Souveränität aussieht, ist in Wahrheit ein verzweifelter Versuch, nicht noch einmal so zu fühlen wie damals, sondern stattdessen „ersatzweise“ zu fühlen.
Es hilft, wenn man versteht, dass hinter dem Stolz oft Scham liegt. Hinter dem Zorn: Angst. Und hinter der Kälte: ein altes Zittern.
Der Ursprung liegt wie gesagt in der Kindheit, in der Vernachlässigung oder in der Überbehütung — in der fordernden Liebe einer Mutter, die das Kind braucht, um sich selbst zu bestätigen, oder im emotionslosen Funktionsmodus eines Vaters, der zwar alles gibt – außer sich selbst. In beiden Fällen bleibt das Kind gewissermaßen allein. Und aus diesem Alleinsein heraus wird ein Ersatz-Selbstbild konstruiert, das andere braucht, um sich real anzufühlen.
Die narzisstische Gesellschaft
Soweit ein kurzer Einblick in die Entstehung von Narzissmus und die Realität, in der narzisstisch geprägte Menschen leben. Solches Wissen hat dazu geführt, dass wir heute viele Menschen kritisch als „narzisstisch“ beschreiben — manchmal mag das zutreffen, aber manchmal wird es sich dabei auch um eine aus Selbstschutz oder Eigennutz heraus formulierte „küchenpsychologische“ Zuschreibung oder um eine schlichte „Ferndiagnose“ handeln. „Narzisst“ wird dann zum (häufig gebrauchten) Schimpfwort — für narzisstische Chefs, narzisstische Ex-Partner usw. Manchmal wird der Begriff auch gezielt manipulativ verwendet: Man kritisiert quasi Manipulation, um von den eigenen Manipulationen abzulenken.
Aber wenn es nur das wäre: Während Narzissmus oft kritisiert wird, wird die Gesellschaft insgesamt narzisstischer. Es handelt sich um eine paradoxe Entwicklung: Auf der einen Seite die öffentliche Kritik, auf der anderen Seite das stille Einüben narzisstischer Muster im Alltag – in Familien, Schulen, Institutionen.
Die Hauptursache für jenes „stille Einüben narzisstischer Muster im Alltag“ ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass wir die Erziehung „umgedreht“ haben, dass sich heuer viele Eltern ihren Kindern unterwerfen, und sich in der Folge auch Schulen und Institutionen zunehmend den wachsenden individuellen Ansprüchen unterwerfen.
Zugespitzt formuliert: Früher bestimmte die Welt der Erwachsenen die Erziehung. Heute dreht sich die Welt um das Kind. Früher bedeutete Erziehung unter anderem: lernen zu warten. Heute bedeutet sie oft: sofort bekommen. Aus dem Wunsch des Kindes wird ein Recht. Und aus dem Recht ein Anspruch.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Wenn man Kinderschutz als Abwesenheit von Gewalt, Vernachlässigung, Unterdrückung und Herabsetzung begreift, und wenn Chancengleichheit die zentrale Orientierungsgröße bildet, ist dem unseres Erachtens nur zuzustimmen. Aber wenn Kinderrechte so übertrieben werden, dass Kinder Ansprüche haben können sollen und Entscheidungen treffen können sollen, zu denen sie kognitiv noch gar nicht in der Lage sind, dann handelt es sich wahrscheinlich um Ideologie (können sollen) oder Unterwerfung (einfach nur können, ohne zu sollen).
In den einkommensstärkeren Haushalten wird ein Kind gleichsam zum „Projekt“ — man hat ja, wenn überhaupt, in den meisten Fällen nur noch ein Kind (die Ein-Kind-Ehe ist der statistisch häufigste Fall, dann folgt die Kein-Kind-Ehe und dann die Ehen oder Beziehungen mit zwei oder mehreren Kindern). Dann muss aus dem Kind, verflixt nochmal, auch etwas werden. Das Problem dabei ist, dass adäquate Förderung und Erziehung oft mit wahlweise Perfektionismus, Unterwerfung aus ideologischen Gründen oder schlicht der „Zuckerkanone“ verwechselt wird.
In einkommensschwächeren Haushalten wird das Kind mitunter zur „letzten Hoffnung auf Zuwendung“ — wenn ich meinen Selbstwert nicht aus der Arbeit ziehen kann, wie dies andere Erwachsene tun, dann bin ich nett zu meinen Kindern und erfülle ihnen jeden Wunsch, damit ich wenigstens einmal am Tag das Gefühl habe, dass mich jemand mag. Am Ende einer gewissen Dynamik haben jüngere Kinder von mitunter deutlich unter zehn Jahren unlimitierten Zugang zu Mobiltelefonen — und fordern sich diesen immer wieder ein, bis sie am Ende mit sieben oder zehn Jahren täglich mehrere Stunden am Handy verbringen — und das für diese Kinder irgendwie „selbstverständlich“ wird.
In beiden Fällen findet keine wirkliche Erziehung statt, sondern eine stille Unterwerfung der Eltern. Die Autorität wird aufgegeben — aus Angst, aus Erschöpfung, aus schlechtem Gewissen, aus ideologischen Gründen, und manchmal auch aus purem Eigennutz.
Damit wächst eine Generation heran, in der eine bestimmte Prägung häufiger wird — ein Typ, der wenig Frustration kennt und deshalb auch nicht genug Frustrationstoleranz entwickeln konnte, und der deshalb auch wenig Empathie besitzt. Empathie entsteht unter anderem durch das Erleben von Grenzen. Wer aber kaum warten musste, kaum verzichten musste, kaum erleben musste, dass das eigene Ich nicht das Zentrum des Geschehens ist, wird später umso schwerer erkennen, dass da auch andere Menschen sind, die Interessen haben usw. — und dass die eigenen Erwartungen, Bedürfnisse und Belange dort enden, wo die Erwartungen, Bedürfnisse und Belange anderer Menschen anfangen.
Die Folgen dieser Entwicklung zeigen sich überall: in Schulen, in Organisationen, in Institutionen. Zwei Beispiele:
- Noten werden hinterfragt. Wenn man ungerecht behandelt wurde, ist das ja ein gutes Recht, aber wenn dieses Recht gleichsam strategisch zur Verbesserung der Note benutzt wird, und wenn Lehrer an Schulen und Prüfungsausschüsse an Hochschulen aufgeben, konsequent zu sein, weil sie keine Kraft und keine Ressourcen für die entsprechenden Diskussionen mehr haben, dann kippt das Notensystem, dann machen Noten keinen Unterschied mehr, dann bekommen irgendwann fast alle eine Eins.
- Dienstpläne sollen sich nicht nur an den Erfordernissen der Organisation orientieren, sondern es geht darum, durch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der Arbeitszeitmodelle eine bessere Vereinbarkeit von persönlichen und dienstlichen Belangen zu ermöglichen. Aber was passiert, wenn das übertrieben wird, und individuelle Ansprüchen völlig selbstverständlich über die Funktionsanforderungen der Organisation gestellt werden? Ein, zugegebenermaßen sehr spitzes und nicht ganz ernst gemeintes, aber hoffentlich umso treffenderes Beispiel: „Das habe ich letzte Woche in der Teamrunde vergessen zu sagen: ich brauche morgen frei. Unser Familienhamster hat Geburtstag, und mein Sohn wünscht sich, dass wir alle zusammen mit dem Hamster den Geburtstag feiern. Ich muss morgen frei haben. Ich habe es meinem Sohn versprochen. … Wenn ich nicht frei bekomme, muss ich mir überlegen, ob ich hier überhaupt arbeiten kann. Sie entscheiden, ob ich hier arbeiten kann. Ich würde gern auch weiterhin hier arbeiten. Es ist Ihre Entscheidung.“
Aus (berechtigtem, verständlichem) Individualismus wird ganz langsam ein sich schleichend verstärkender „Anspruchsradikalismus“.
Dabei bleibt das (narzisstische) Bedürfnis nach Bedeutsamkeit oft ungestillt. Es wächst mitunter sogar und sucht sich neue Kanäle — zum Beispiel den Aktivismus. Wer heute Teil einer Bewegung ist, ist oft auch Teil einer Inszenierung. Nicht immer aus Kalkül, oft aus Not — und weil „Sinn“ gebraucht wird wie die Luft zum Atmen. Weil glaubhafte Ziele und Inhalte oft durch banales, aber umso wirksameres Rechthaben und Moralisieren ersetzt werden. Aber vor allem, weil sich das (narzisstische) Ich nur im Spiegel anderer erkennen kann.
Die Gesellschaft hat durch die fortschreitende Individualisierung in gewissem Sinne die Bindung, den sozialen „Klebstoff“, verloren und sucht nun Ersatz – in Anerkennung, in Likes, in Zugehörigkeit zu moralischen Eliten. Aber Bindung lässt sich nicht einfach so herstellen. Zustimmung allein reicht nicht. Es braucht auch Frustrationstoleranz, und die bedeutet gesellschaftlich vor allem das gemeinsame Aushalten von Widersprüchen, Gegensätzlichkeiten usw.
Und genau das verlernen wir gerade.
Wir sind nicht mehr bereit, irgendwas gemeinsam auszuhalten. Wir moralisieren oder wir sind dagegen. Wir sind dagegen, oder wir moralisieren. Jede beliebige Seite meint, sie habe Recht, und eine jeweils andere Seite sei das Übel. Ein perfekter Teufelskreis, dessen Dynamik sich selbst verstärkt.
Wem diese Darstellungen hier zu knapp und ggf. noch zu unverständlich sind, die oder der findet hier einen längeren Text über die Zusammenhänge zwischen „Toleranzaktivismus“, Narzissmus und Dekadenz.
Führen im Zeitalter wachsenden Narzissmus’
Führungskräfte begegnen heute einer wachsenden Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schneller „aufbrechen“ als „ankommen“, die sich weniger binden, die weniger „Frust“ oder „Stress“ aushalten — weil sie gelernt haben, dass sie das nicht müssen, und oft genug auch, weil sie das gar nicht mehr wollen. Narzisstischer werdende Menschen leiten ihr Selbstwertgefühl stärker aus Rückmeldungen ab als aus innerer Stabilität. Bei Kritik gehen diese Menschen weniger in die Reflexion, sondern eher in die Eskalation.
Das bedeutet praktisch: Die durchschnittliche Verweildauer in Organisationen sinkt. Die Irritationspotentiale nehmen zu. Die Loyalität bröckelt. Und gleichzeitig steigen die Ansprüche – an Wertschätzung, Mitsprache, Sinn und vor allem Anpassung der Organisation an individuelle Ansprüche.
Was bedeutet das für Führungskräfte?
Erstens: kürzere Planungszyklen. Narzisstisch geprägte Mitarbeitende „ticken“ kurzfristiger. Langfristige Ziele motivieren weniger als unmittelbare Wirksamkeit. Führung sollte das akzeptieren. Gleichzeitig darf man nicht alles dem Zeitgeist hinterherwerfen. Das ist eine schwierige Gratwanderung.
Zweitens: höhere Beziehungspräsenz. Wer führen will, muss als realer Mensch spürbar bleiben. Nicht als Rolle, nicht als Funktion, sondern als echtes Gegenüber. Führung bedeutet heute, auch emotionale „Containerfunktionen“ zu übernehmen. Man bekommt stärkere Eskalationen ab, ohne dass man selbst eskalierend antworten darf. Man ist als Führungskraft gleichsam zum Verständnis, zur Geduld und zum „klüger Sein“ verurteilt — denn sonst rennen die (narzisstischen) Mitarbeiter ggf. weg, bevor sie lernen konnten, was ihre Eskalationen tatsächlich bedeuten.
Drittens: Klarheit und Grenzen. Narzissten testen Systeme — nicht aus Bosheit, sondern weil ihnen ein innerer (empathischer) Kompass fehlt. Wer sich selbst nicht spürt, spürt andere noch weniger. Grenzen geben Halt. Nicht durch Härte, sondern durch Verlässlichkeit.
Viertens: Reflexion statt Reaktion. Wer sich von der Emotionalität narzisstischer Kränkungen anstecken lässt, verliert die Führung. Wer sie versteht und angemessen reagiert, bleibt handlungsfähig.
Denn die Narzisstin oder der Narzisst lebt mit einem tiefen Gefühl ständiger Bedrohung: Kritik wird zunächst nicht als Impuls zur Entwicklung verstanden, sondern als Angriff auf die Existenz. Und aus dieser Bedrohung heraus entsteht oft die plötzliche Eskalation – der Vorwurf, der Rückzug, die Kündigungsdrohung.
Führung heißt dann: nicht mit Eskalation auf Eskalation reagieren. Sondern den Raum und die Beziehung offen halten und auf wertschätzende Weise Struktur bieten, um aus Kritik tatsächlich Entwicklung werden zu lassen. Vertrauen allein reicht nicht, denn Narzissten wissen unter Druck nichts mehr von Vertrauen, sondern nur noch etwas von Bedrohung. Führung bedeutet hier, das (narzisstische) Gegenüber „gleichsam ins Vertrauen zurückzucoachen“.
Und fünftens: Akzeptanz für das, was ist. Nicht jede Organisation wird alle Mitarbeitenden langfristig halten können. Aber sie kann Räume schaffen, in denen Bindung möglich wird – auch wenn sie nicht garantiert ist.
Das bedeutet, sich an eine insgesamt stärkere Fluktuation zu gewöhnen und die Einarbeitung als permanenten Prozess zu betrachten — und diesen Prozess kontinuierlich zu verbessern.
Denn das ist die zentrale Herausforderung angesichts wachsenden Narzissmus’ in der Gesellschaft: Auch Menschen zu halten, die kaum gelernt haben zu bleiben, bzw. die nur bleiben, wenn sie sich sicher fühlen; sie werden sich aus sich selbst heraus aber nicht sicher fühlen, sie können das nur langsam, sehr langsam lernen, und dafür braucht es eine ebenso kluge wie geduldige Führung, die (1) nicht „miteskaliert“ und (2) klüger handelt, indem sie Rückhalt trotz Eskalation und Drohung signalisiert.
PS: Das Beitragsbild wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Nachwort
Wie eingangs bereits angemerkt, könnten die hier vorgeschlagenen Haltungen und Vorgehensweisen einigen Leserinnen und Lesern als zu unkritisch und zu akzeptierend gegenüber narzisstischen Verhaltensweisen erscheinen. Aber wenn, wie hoffentlich nachvollziehbar dargestellt wurde, der Anteil narzisstischer Verhaltensweisen insgesamt steigt, dann ist innerhalb von Organisationen nach unserem Dafürhalten eher die Frage nach einem funktionierenden Umgang zu stellen. Denn in Organisationen geht es darum, die Strukturen und Vorgehensweisen so zu gestalten, dass ein gemeinsames/kooperatives Einzahlen auf den Organisationszweck möglich wird. Die Eigenheiten und Belange einzelner Personen spielen dabei auch eine Rolle, aber eben eine periphere. Es geht also nicht um Narzissmus oder Kritik an narzisstischen Handlungsmustern, sondern es geht um einen möglichst funktionalen Umgang mit Narzissmus in Organisationen. Und das ist die Aufgabe von Führungskräften.
Es kann natürlich passieren, dass man des geduldig Seins, immer wieder Probierens und immer wieder zurück ins Vertrauen Coachens müde wird, oder dass sich solche Vorgehensweisen irgendwann wie Gesichtsverlust oder Unterwerfung anfühlen. Keine der hier vorgeschlagenen Haltungen oder Vorgehensweisen funktioniert in jedem Fall oder für immer. Natürlich kommt man an Grenzen.
Eine letzte, hier nicht beleuchtete Variante ist die des „den sprichwörtlichen Spieß Herumdrehens“: Man eskaliert ebenfalls, man stellt seinerseits finale Konsequenzen in Aussicht. Das kann natürlich schiefgehen, aber oft genug geht es nicht schief, sondern oft genug ist genau das ein Zeichen für das (narzisstische) Gegenüber, dass nun „Schluss mit lustig“ ist, was oft genug dazu führt, dass man ernst genommen wird.
Man betritt also die Welt eines Menschen, der mit einem beständigen Bedrohungsgefühl lebt und unter Druck mitunter stark drohende Formulierungen wählt, seinerseits mit einer Drohung. Auch das kann eine Sprache sein, die ein (narzisstisches) Gegenüber versteht. Manchmal ist es sogar die einzige Sprache, die ein narzisstisches Gegenüber versteht. Man muss vorher aber eine Konsequenzanalyse durchführen und überlegen, ob das wirklich die letzte Karte ist, die man spielen kann, bzw. ob man den Preis bezahlen möchte und kann, der anfällt, falls das nicht klappt. Oft genug funktioniert das, aber es kann eben auch schiefgehen — und wenn es schiefgeht, ist nachher alles kaputt. Damit muss man dann leben (können).